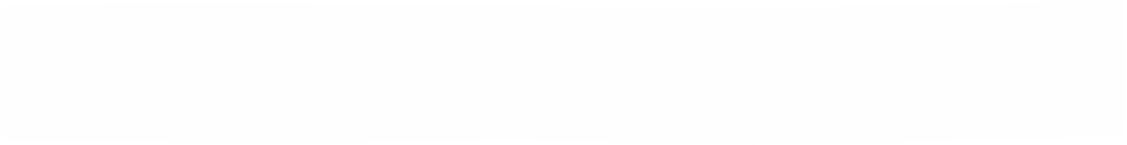
Von Männerleid und toxischer Männlichkeit
Bittl, Hussock und Veit mit „Indien“ in Trostberg: Entscheidende Millisekunden des Nichtssagens.
„I bin ja koa Beilagenesser in dem Sinn.“ Da ist der Heinz Bösel ganz anders als – nun, nehmen wir zum Beispiel den Inder. Inder essen ja überhaupt nur Reis. Die sitzen auf der Straße, essen Reis, lachen dabei, manche verhungern. Typische Beilagenesser halt. Ziehen den Hungertod einem, sagen wir mal, Rindsgulasch vor. Diese fremden Völker. Eigen. Ein jeder, wie er glaubt.
Nein, der Heinzi ist eher ein Schnitzelesser. Ein professioneller. Wiener Schnitzel müssen vom Kälbernen sein; sind’s vom Schwein, dann dürfen‘s nur als Schnitzel Wiener Art auf der Karte stehen. In irgendeinem Dorfwirtshaus musste er mal eineinhalb Stunden auf ein Zigeunerschnitzel warten. Skandal. In so einem Fall schreibt der Fremdenverkehrskontrolleur Bösel der Boazn eine Bewertung, dass sie im nächsten Jahr nur mehr Flüchtlinge bewirten kann. Wobei sich da der Inder immer noch glücklich schätzen dürfte. Statt daheim auf der Straße mit oder ohne Beilage zu verhungern…
Bösels Kollege Kurt Fellner hat einen entspannteren weil interessierteren Blick auf Eigenheiten anderer Völker. Die Japaner beispielsweise essen die Suppe am Schluss und den Fisch roh. Oder die Malaien, die dem Affen den Schädel aufklopfen und das Hirn rauslöffeln. Er selbst hält sich ans Grünfutter. Salatplatten, dazu einen Orangensaft, frisch gepresst. Gemüse halt. Drum ist er als Tourismusinspektor auch eher Spezialist für die Funktionalität von Duschen, die korrekte Ausweisung von Fluchtwegen und die ordnungsgemäße Montage von Saunageländern und Brandschutztüren. Jeder hat so sein Spezialgebiet. In einem sind sich der Bildungsbürger Fellner und der Kleinbürger Bösel aber einigermaßen einig: Nimmt man 90 Prozent der Wirte, dann kann man sagen: Zu 100 Prozent sind das Deppen.
So ein gemeinsames Feindbild hilft ungemein bei der Teamarbeit. Zumindest kann’s die Klüfte zwischen beiden notdürftig kaschieren. Die österreichischen Kabarettisten Alfred Dorfer und Josef Hader haben in ihrem Theaterstück „Indien“ zwei Charaktere zusammengespaxt, die ziemlich gar nichts miteinander anfangen können. Zwei Archetypen haben sie geschaffen: Auf der einen Seite der vom Leben desillusionierte Bösel, der seine Vorurteile pflegt und den Weg des geringsten Widerstands geht, ein bisserl Korruption hier, ein bisserl Xenophobie dort und dazwischen ein gerüttelt Maß Frauenverachtung.
Auf der anderen Seite der überkorrekte Streber, der noch Karriere machen will, ein mit Hilfe seiner Trivial-Pursuit-Karterln unnützes Wissen anhäufender Tüpferlscheißer, der seine Freundin offenbar final genervt hat mit seiner intellektuellen Kleinteiligkeit – drei, zwo, eins, Küsschen, ein schwer erträgliches Gscheithaferl. Beide ungustiös, aber immerhin größtenteils harmlos.
Zeitloses Kabinettstückerl
Ein zeitloses Kabinettstückerl haben Hader und Dorfer mit ihrer Tragikomödie „Indien“ geschaffen. Die Bösels und Fellners nerven heute wie vor 30 Jahren. Und wie vor 30 Jahren kann der Zuschauer dabei seinen eigenen Bösel, seinen eigenen Fellner in sich finden. Klar, niemand hat diese Unsympathen so überzeugend, einnehmend und ergreifend auf die Bühne gebracht wie ihre Schöpfer. Das Stück funktioniert aber immer noch. Natürlich auch in der Version, die Andreas Bittl, Sven Hussock und Anna Veit im Trostberger Postsaal aufgeführt haben.
Wobei manches – im Vergleich zum Original natürlich – ein bisschen unrund daherkommt. Zeitgeist soll sich widerspiegeln. Wo Dorfers Fellner noch konstatiert, so richtig den Rhythmus im Blut haben eigentlich eh nur die Neger, sind’s bei Hussock die Schwarzafrikaner. Eine unnötige Korrektur, weil die Neufassung politisch kaum korrekter und kaum weniger rassistisch ist als das Original. SARS-CoV-2 notdürftig einzuflicken ist genauso überflüssig – Bösel identifiziert Fellners Hodenkrebs als „irgend so eine Virusg’schicht. Naa, ned der!“. Braucht’s nicht. Für einen Lacher zu wenig. Corona nervt.
Am schwierigsten – im Vergleich zum Original natürlich – ist der Kniff, dass Hussock seinen Fellner hessisch anlegt. Liegt zwar nahe, der Schauspieler ist gebürtiger Gießener, aufgewachsen in Frankfurt. Bittl als Bösel ignoriert den Appelwoi, den Aschebescher, das Babbele, Dribbe und Druff. Sehr unwahrscheinlich für einen eingeschworenen Bayern, der ansonsten allem Fremden feindselig gegenübersteht. Das ist nicht stimmig. Und auch die Verlagerung des Besserwisserischen von Fellner auf die Bedienung alias Veit erschließt sich nicht wirklich. Damit kickt die Regie ohne Not die wesentliche Triebfeder für Fellners Überlegenheitsgefühl Bösel gegenüber aus dem Stück.
Die Distanz zwischen den beiden wäre durch ein gemeinsames Idiom zweifelsohne augen- wie ohrenfälliger. So bleiben sie, jeder für sich, arme Würschterl, gefangen in der Enge ihrer Tellerränder. Quasi eine Ahle Wurst und eine Weißwurst.
Im ersten Akt überbrücken Bittl, Hussock und Veit die Szenenwechsel zwischen den begutachteten Wirtshäusern mit Gesang. Eichendorffs „In einem grünen Grunde“, dreistimmig dargeboten. Die letzte Zeile „Ich möcht’ am liebsten sterben, da wär’s auf einmal still!“ deutet den Lauf der Geschichte an. Warum eigentlich? Beim nächsten Umbau beschränken sich die Akteure drauf, das Lied zu summen und nur noch „sterben“ zu singen. Das ist schon arg beziehungsweise „arsch“, wie der Hesse sagt, mit dem Holzhammer. Auch spätere Lieder von Freundschaft und vom guten Kameraden bringen die Dramaturgie nicht voran. Aber wenigstens ist gesungen worden. Wie wenig stringent die Überbrückungsmusik fürs Stück ist, zeigt sich nach der Pause. Der zweite Akt spielt in einem Krankenhaus, das renoviert wird. Die Szenenwechsel werden dann nicht mehr mit Liedern begleitet, sondern durch Pressluftgehämmere aus der Konserve. Fanden sich keine passenden Lieder? Macht nix. Kann weg.
Ensemble setzt zeitgemäße eigene Akzente
Außer diesen ansatzweise ungelenken Beigaben setzen Bittl, Hussock und Veit aber durchaus wesentliche eigene Akzente. Zeigen Dorfer und Hader die Korrumpierbarkeit des kleinen Mannes, wenn er sich innerhalb seiner bescheidenen Möglichkeiten als mächtig wähnt, arbeiten Bittl, Hussock und Veit heraus, wie eine plötzliche alkohol- und weltschmerzmotivierte Männerfreundschaft in Anwesenheit einer Frau nahezu nahtlos in toxische Männlichkeit umschlägt. Fellner und Bösel wünschen sich von der Wirtin eine Tanzlustbarkeit, nichts Professionelles, am liebsten von einer 13-jährigen Tochter der Wirtin. Eine ekelhafte bsoffene Gschicht.
Im Leid finden Heinzi und Kurtl zueinander
Frauen. Bösel hat da eine klare Meinung: Am Anfang müsse man schon schön reden mit ihr, „schön schauen, was trinken – aber im entscheidenden Moment musst du zuschlagen. Das ist wie bei einer Sprungschanze. Da musst du auch im richtigen Moment wegfliegen. Da kannst du dich nicht fragen: Ist das jetzt gut für die Schanze oder nicht?“ Seine Schanze hat ihm bei der Gelegenheit ein Kuckuckskind untergeschoben. Er duldet’s mit heimlichem Grimm.
Dem Kurtl wird indes während seiner Gastrotourabwesenheit der Anrufbeantworter in seiner frisch erworbenen Eigentumswohnung neu besprochen. Von einem anderen Mann. Daraufhin gibt’s ein Frühstück für Helden – Obstler und eine Schnitzelsemmel für Bösel, Obstler ohne Schnitzelsemmel für Fellner. Man(n) leidet gemeinsam bis zum Abend. Und sind wir doch mal ehrlich: So leidet sich’s noch immer am schönsten.
Inszenierung ist komisch, tragisch, menschliche Untiefen auslotend
Mehr Gelegenheit zum gemeinsamen Leiden gibt’s im zweiten Akt. Fellner hat Krebs und noch zwei Wochen zu leben. Bösel hat keinen Krebs, aber nur noch für zwei Wochen einen Freund. Dann wieder nur eine Frau und einen Sohn, der nicht von ihm ist. Und einen neuen Kollegen, den Schremser – ein Primitivling, mit dem man nicht reden kann. Fellners Changieren zwischen Schicksalsergebenheit, Wiedergeburtshoffnung und Panik, Bösels existenzielles Herumgeworfensein zwischen Verlustangst, Fürsorge, Freundschaft und Herzeleid, das alles bringen Hussock und Bittl eindringlich auf die Bretter. Ihr „Indien“ ist komisch, ist tragisch, lotet menschliche Untiefen aus. Am stärksten ist das Ensemble, wenn es nah am Original bleibt. Dort, wo sie dazuerfinden, wird‘s bisweilen des Guten zu viel. Kunst ist oft die Kunst des Weglassens. Hier ganz bestimmt.
Gut, das ist Kritikasterei auf hohem Niveau. Wer das Original nicht kennt, wird mit diesem „Indien“ bestens bedient. Wer allerdings um Haders und Dorfers perfektes Timing weiß, der weiß auch, wie’s besser geht. Wo Haders Bösel die Kunst der Pause im Schlaf beherrscht, versucht Bittls Bösel immer postwendend zu kontern. Da geht’s um Millisekunden des Nichtssagens, die aus Bösel entweder einen lernfähigen, mitleidenden wie bemitleidenswerten Empathling oder eine den gesellschaftlichen Konventionen verhaftete, eilfertige Projektionsfläche seiner selbst machen. Das eine rührt zu Tränen, das andere zeigt: So ist er. Typisch Mann. Mehr Erkenntnisgewinn bringt sicher zweiteres – was für des Effekt eines Theaterstücks nicht ganz unwesentlich sein mag. Menschelnder aber ist der Hadersche Bösel, dem man beim Denken zuschauen kann. Dann wird’s ergreifend. Aber wer wollte schon im Postsaal heulen?
Text & Fotos: Andreas Falkinger




